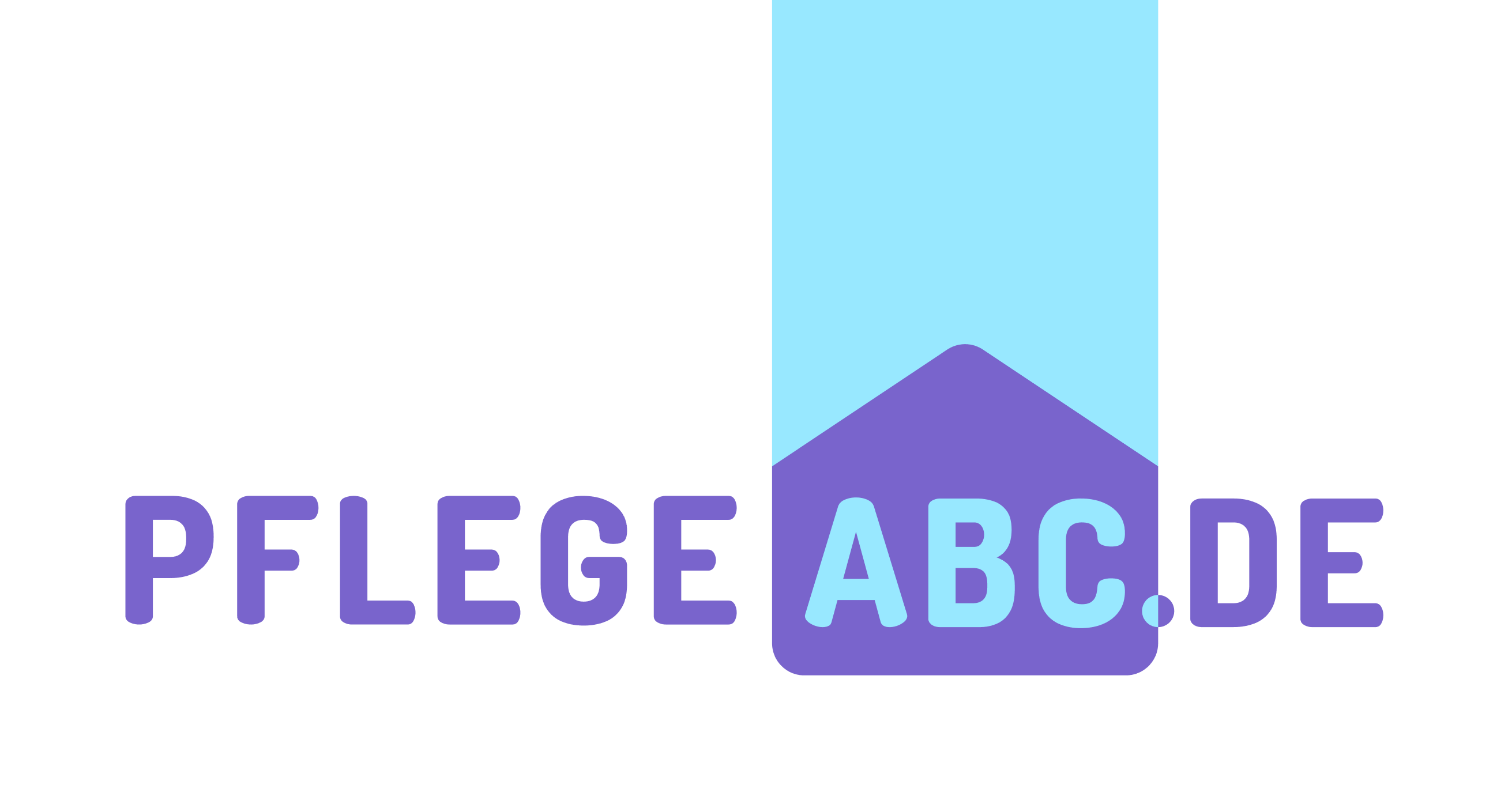Write your awesome label here.
Grad der Behinderung beantragen - Rechte, Vorteile und Ablauf im Überblick
Thea Regenberg
Manchmal verändern gesundheitliche Einschränkungen oder chronische Erkrankungen das Leben von einem Tag auf den anderen. Der Alltag wird anspruchsvoller, gewohnte Abläufe geraten ins Wanken, und vieles, was selbstverständlich war, muss neu organisiert werden. In dieser Situation ist es verständlich, dass Sie sich fragen, wie Sie sich mehr Unterstützung und Sicherheit im Alltag sichern können. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist der Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung (GdB). Diese Einstufung gibt Ihnen die Möglichkeit, konkrete Hilfen in Anspruch zu nehmen, von steuerlichen Entlastungen über arbeitsrechtlichen Schutz bis hin zu finanziellen Leistungen und mehr gesellschaftlicher Teilhabe. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie den Grad der Behinderung beantragen können, welche Vorteile Sie bereits ab einem GdB von 20, 30 oder 50 haben und welche Schritte Ihnen offen stehen, wenn Sie mit einer Entscheidung der Behörde nicht einverstanden sind.
Was bedeutet der Grad der Behinderung?

Der Grad der Behinderung (GdB) gibt an, wie stark eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder chronische Erkrankung Ihr tägliches Leben beeinflusst. Die Einstufung erfolgt in Zehnerschritten von 20 bis 100, wobei 20 den niedrigsten und 100 den höchsten Wert darstellt. Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei diesen Zahlen nicht um Prozentangaben handelt. Sie geben nicht in Prozent an, wie stark Sie eingeschränkt sind, sondern dienen der rechtlichen Einordnung und Bestimmung von Nachteilsausgleichen.
Es werden nicht einfach alle Einschränkungen addiert, sondern die Auswirkungen auf Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in ihrer Gesamtheit betrachtet. Wenn Sie zum Beispiel eine Einschränkung haben, die mit GdB 30 bewertet wird, und eine weitere mit GdB 50, ergibt dies nicht automatisch einen GdB von 80. Stattdessen wird geprüft, wie sich beide Einschränkungen zusammengenommen auf Ihren Alltag auswirken, und es könnte ein GdB von 60 festgestellt werden. Entscheidend ist also, wie sehr Ihre Erkrankungen oder Behinderungen Ihr Leben insgesamt beeinflussen.
Nach §2 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) gilt ein Mensch mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr als schwerbehindert. Erst ab diesem Wert haben Sie Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis und die Rechte, die mit diesem Status verbunden sind.
Nach §2 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) gilt ein Mensch mit einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr als schwerbehindert. Erst ab diesem Wert haben Sie Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis und die Rechte, die mit diesem Status verbunden sind.
Wer legt den Grad der Behinderung (GdB) fest?
Die Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) liegt in der Verantwortung des Versorgungsamtes oder je nach Bundesland, einer vergleichbaren Behörde wie dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Dort werden alle von Ihnen eingereichten Unterlagen sorgfältig geprüft. Um eine faire und fundierte Einschätzung zu gewährleisten, beauftragt die Behörde interne oder externe ärztliche Gutachterinnen und Gutachter mit der medizinischen Bewertung Ihrer gesundheitlichen Situation. Grundlage für diese Einstufung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV), auch bekannt als Versorgungsmedizinische Grundsätze. In dieser Verordnung ist detailliert festgelegt, wie unterschiedliche Erkrankungen und Einschränkungen bewertet werden und wie daraus eine Gesamteinschätzung des GdB entsteht.
Die Entscheidung basiert ausschließlich auf den Auswirkungen Ihrer Erkrankungen auf Ihr tägliches Leben und nicht allein auf Diagnosen. So kann der Verlust eines Arms zu einem GdB von 70 führen, während die Entfernung des Magens oft mit einem GdB zwischen 40 und 50 bewertet wird. Jede Einschränkung wird einzeln betrachtet und dann zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Es ist möglich, dass der GdB im Laufe der Zeit erneut überprüft wird oder unbefristet gilt. In beiden Fällen ist eine Anpassung wichtig, wenn sich Ihr Gesundheitszustand deutlich verbessert oder verschlechtert.
Wie bekomme ich einen Grad der Behinderung (GdB)?

Diese Unterlagen benötigen Sie für den Antrag auf einen GdB
Beratung vor dem Antrag: Warum sich Unterstützung lohnt und wichtig ist
Unterstützende Vorteile bei GdB 20, 30 und 50

Ist eine Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 möglich?
Grad der Behinderung 50 und Rente
Grad der Behinderung: Widerspruch - Schritt für Schritt

- Bescheid prüfen und Frist beachten
Lesen Sie den Bescheid sorgfältig durch. In der Regel haben Sie einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Wenn keine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten ist, verlängert sich die Frist auf drei Monate. Dies ist aber eher selten. - Widerspruch einreichen
Senden Sie Ihren Widerspruch schriftlich an das Versorgungsamt, das den Bescheid ausgestellt hat. Sie können ihn auch persönlich abgeben und dort zu Protokoll geben. Lassen Sie sich eine Bestätigung geben. Eine E-Mail reicht nicht aus.
Tipp: Begründung vorbereiten und Nachweise beifügen
Legen Sie in Ihrem Schreiben dar, warum Sie die Entscheidung für falsch oder unvollständig halten. Eine ausführliche und gut belegte Begründung erhöht Ihre Erfolgschancen erheblich. Aktuelle Arztberichte, Gutachten oder Befunde helfen, Ihre gesundheitlichen Einschränkungen besser zu dokumentieren. - Prüfung durch das Versorgungsamt
Nach Eingang des Widerspruchs wird Ihr Fall erneut geprüft. Es können weitere Gutachten angefordert oder zusätzliche Stellungnahmen eingeholt werden. Wenn das Versorgungsamt Ihrem Widerspruch nicht sofort stattgibt, entscheidet ein Widerspruchsausschuss über den Fall. - Klage beim Sozialgericht
Wird der Widerspruch abgelehnt, können Sie innerhalb von einem Monat Klage beim Sozialgericht einreichen. Dieses Verfahren ist in der Regel kostenfrei oder kostengünstig, und Sie können Prozesskostenhilfe beantragen. - Neufeststellung beantragen
Wenn sich Ihr Gesundheitszustand später verschlechtert, können Sie jederzeit einen neuen Antrag auf Erhöhung des GdB stellen.
Fazit: Ein Antrag für mehr Teilhabe und Sicherheit
Den Grad der Behinderung zu beantragen, kann sich zunächst mühsam und bürokratisch anfühlen. Oft steht auch die Frage im Raum: Benötige ich so etwas überhaupt schon? Doch dieser Schritt kann ein wichtiger Schlüssel für mehr Unterstützung, Sicherheit und Lebensqualität sein. Ein anerkannter GdB macht Ihre Einschränkungen sichtbar und sorgt dafür, dass Sie die Hilfe und Entlastungen bekommen, die Ihnen im Alltag zustehen, sei es in Form von finanziellen Vorteilen, besonderem Kündigungsschutz, Mobilitätshilfen oder gesellschaftlicher Teilhabe. Das Gute daran ist: Sie müssen diesen Weg nicht allein gehen. Beratungsstellen, Sozialverbände und Pflegestützpunkte stehen Ihnen zur Seite, hören Ihnen zu und begleiten Sie. Es ist vollkommen in Ordnung, Unterstützung anzunehmen und sich Hilfe zu holen. Mit einer guten Vorbereitung, Geduld und fachkundiger Begleitung sind Sie auf einem sicheren Weg.
Grad der Behinderung beantragen: Häufig gestellte Fragen
Wie beantrage ich einen Grad der Behinderung (GdB)?
Um den Grad der Behinderung zu beantragen, stellen Sie einen Antrag bei Ihrem zuständigen Versorgungsamt oder einer entsprechenden Landesbehörde. Der Antrag kann vor Ort oder in vielen Bundesländern auch online ausgefüllt und eingereicht werden. Sie müssen aktuelle medizinische Unterlagen wie Arztberichte, Reha- oder Pflegegutachten beifügen. Eine gute Vorbereitung und Beratung hilft Ihnen dabei, z. B. durch Sozialverbände oder Pflegestützpunkte.
Welche unterstützenden Vorteile gibt es bei GdB 20, 30 und 50?
Bereits ab GdB 20 können Sie einen Steuerfreibetrag von 384 Euro pro Jahr geltend machen. Mit GdB 30 haben Sie die Möglichkeit, sich schwerbehinderten Menschen gleichzustellen und erhalten so Kündigungsschutz sowie weitere Hilfen im Berufsleben, wenn die Voraussetzungen stimmen. Ab GdB 50 gelten Sie offiziell als schwerbehindert. Damit stehen Ihnen ein Steuerfreibetrag von 1.140 Euro, zusätzliche Urlaubstage, Mobilitätsvergünstigungen, Hilfen beim Renteneintritt und weitere Nachteilsausgleiche zu.
Wie wird der Grad der Behinderung eigentlich ermittelt?
Die Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) liegt in der Verantwortung des Versorgungsamtes oder je nach Bundesland, einer vergleichbaren Behörde wie dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Grundlage für diese Einstufung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV), auch bekannt als Versorgungsmedizinische Grundsätze. In dieser Verordnung ist detailliert festgelegt, wie unterschiedliche Erkrankungen und Einschränkungen bewertet werden und wie daraus eine Gesamteinschätzung des GdB entsteht.
Was bringt der Grad der Behinderung 50 in Bezug auf die Rente?
Mit einem GdB von 50 können Sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen beantragen. Dazu müssen Sie mindestens 35 Versicherungsjahre nachweisen, zu denen auch Kindererziehung, Pflege oder bestimmte Ausbildungszeiten zählen. Für Jahrgänge ab 1964 ist eine abschlagsfreie Rente ab 65 Jahren möglich; ein früherer Renteneintritt ab 62 Jahren ist mit Abschlägen von maximal 10,8 % möglich.
Was kann ich tun, wenn ich mit meinem GdB-Bescheid nicht einverstanden bin?
Wenn Sie glauben, dass Ihr GdB zu niedrig angesetzt wurde, können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Wichtig ist eine gute Begründung mit aktuellen ärztlichen Unterlagen. Das Versorgungsamt prüft dann erneut, und im Zweifel entscheidet ein Widerspruchsausschuss. Bei einer Verschlechterung Ihres Gesundheitszustands können Sie jederzeit einen Antrag auf Erhöhung stellen.

Zur Autorin
Thea Regenberg
Als erfahrene Altenpflegerin kennt sich Thea Regenberg mit den besonderen Bedürfnissen älterer Menschen bestens aus. Im Pflege ABC teilt sie ihr Fachwissen in der Grund- und Behandlungspflege, sowie der Organisation und Dokumentation von medizinischen und pflegefachlichen Abläufen.
Neue Artikel in unserem Magazin
Zum Newsletter anmelden
Erhalten Sie regelmäßig kostenlose Updates.
Vielen Dank.
Wir haben Ihnen eine Mail geschickt. Bitte bestätigen Sie den enthaltenen Link.
Wir haben Ihnen eine Mail geschickt. Bitte bestätigen Sie den enthaltenen Link.