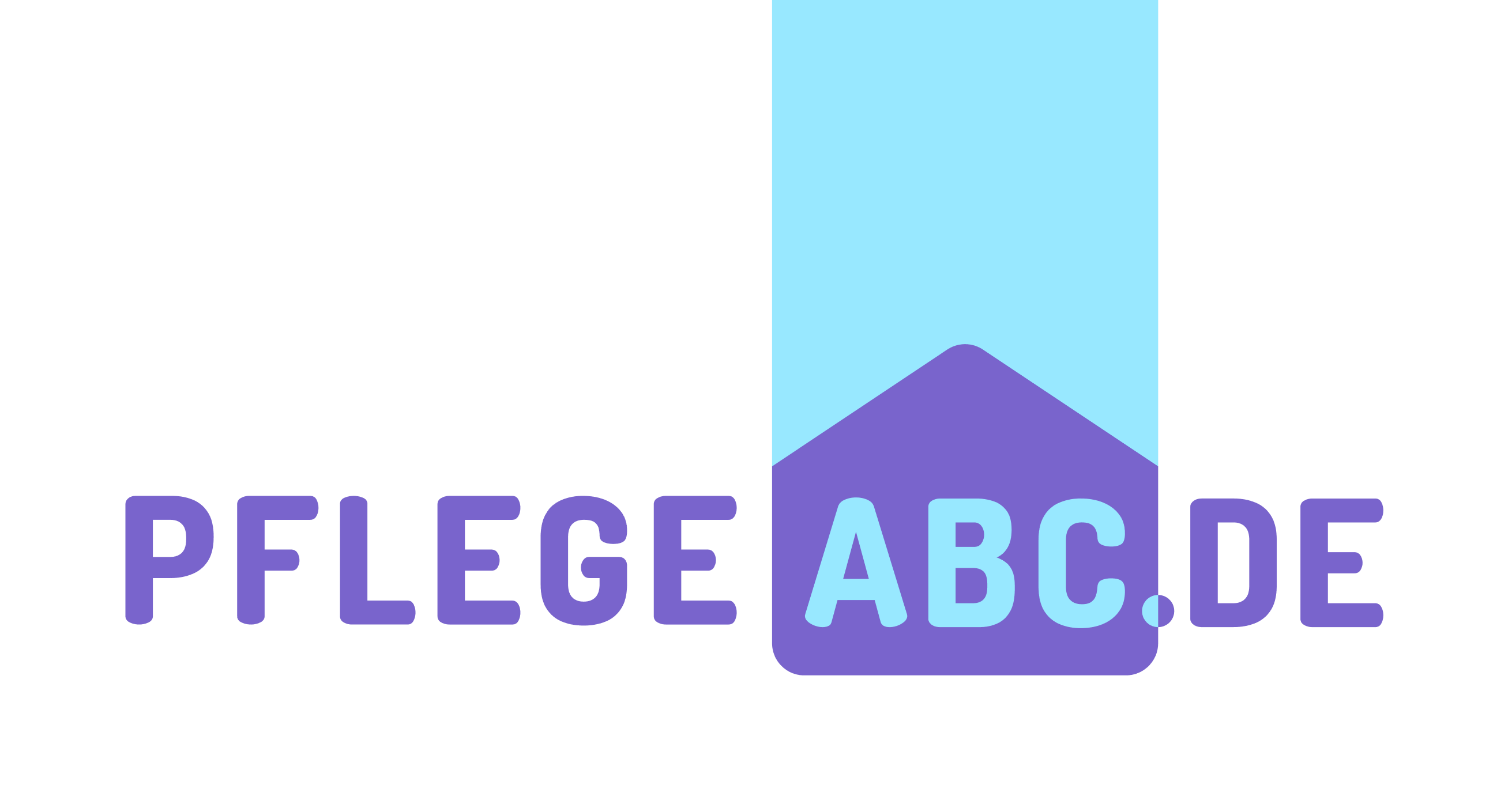Write your awesome label here.
Dekubitus: Risikofaktoren, Behandlung, Prophylaxe
Isabell Jungesblut
Wenn Sie jemanden pflegen, der viel liegt oder sitzt, wissen Sie: Die Haut braucht ganz besonders viel Aufmerksamkeit.
Denn je länger eine Körperstelle belastet wird, desto größer ist die Gefahr, dass sich ein Dekubitus - also ein Druckgeschwür - entwickelt.
Für Sie als pflegende Person heißt das oft: Sie tragen eine große Verantwortung – aber Sie sind nicht allein.
Damit Sie gut vorbereitet sind, erfahren Sie in diesem Beitrag, wie ein Dekubitus entsteht, worauf Sie besonders achten sollten und wie Sie mit gezielten Maßnahmen vorbeugen können.
Was ist ein Dekubitus? – Definition und Entstehung
Ein Dekubitus, auch Druckgeschwür oder Wundliegegeschwür genannt, ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes, die durch anhaltenden Druck oder Druck in Verbindung mit Scherkräften entsteht.
Wenn die Belastung zu lange anhält – etwa beim Liegen, Sitzen oder durch schlecht sitzende Kleidung oder Verbände – werden die feinen Blutgefäße zusammengedrückt. Dadurch gelangt zu wenig Sauerstoff und zu wenig Nährstoffe ins Gewebe. Gleichzeitig können Stoffwechselprodukte nicht mehr richtig abtransportiert werden.
Ohne Entlastung kann sich so Schritt für Schritt eine tiefergehende Wunde entwickeln, die nur schwer heilt.
Besonders gefährdet sind Körperstellen über knöchernen Vorsprüngen – etwa das Steißbein und Gesäß, die Fersen, Ellenbogen, Schultern, der Hinterkopf und die Ohren.
Auch bei sitzenden Personen sind die Sitzbeinhöcker stark gefährdet.
Je weniger Bewegung möglich ist, desto größer ist das Risiko, dass sich eine Druckstelle bildet.
Die Stadien eines Dekubitus – vom ersten Anzeichen bis Grad 4

Ein Dekubitus wird in vier Stadien unterteilt. Diese Einteilung hilft, das Ausmaß des Schadens richtig einzuschätzen und die passende Behandlung einzuleiten.
Dekubitus Grad 1
Dekubitus Grad 1
Zu Beginn ist die Haut gerötet, aber noch intakt. Ein wichtiges Erkennungszeichen ist die nicht wegdrückbare Rötung – bleibt die Haut also auch nach leichtem Druck rot, liegt bereits eine Schädigung vor. Betroffene Stellen fühlen sich oft warm, hart oder empfindlich an. Jetzt ist Handeln wichtig: Nur durch schnelle Druckentlastung kann eine Verschlimmerung verhindert werden.
Tipp: Mit dem sogenannten Fingertest lässt sich prüfen, ob die Rötung harmlos ist oder nicht. Drücken Sie die betroffene Stelle kurz mit dem Finger ein. Wird sie kurzzeitig hell, ist sie wegdrückbar – kein Dekubitus. Bleibt sie rot, liegt wahrscheinlich ein Dekubitus Grad 1 vor, und ein Arzt sollte hinzugezogen werden.
Dekubitus Grad 2 – die Haut ist verletzt
In diesem Stadium sind die obersten Hautschichten bereits beschädigt. Es zeigt sich eine offene, nässende Wunde oder Blase, die leicht entzündlich und sehr schmerzhaft ist.
Dekubitus Grad 3 – tiefere Gewebeschäden
Hier ist die Schädigung bis ins Unterhautfettgewebe fortgeschritten.
Es entsteht ein tiefer Wundkrater, manchmal mit abgestorbenem Gewebe - sogenannten Nekrosen.
Dekubitus Grad 4 – schwerste Form
Bei einem Dekubitus Grad 4 sind alle Hautschichten zerstört und oft liegen Muskeln, Sehnen oder sogar Knochen frei. Diese Wunden sind infektionsgefährdet und brauchen eine lange, intensive Behandlung.
Manchmal lässt sich nicht auf den ersten Blick erkennen, wie tief eine Druckwunde tatsächlich ist.
Wenn die betroffene Stelle mit Belägen oder festem Schorf bedeckt ist, spricht man von einem nicht klassifizierbaren Dekubitus.
In diesem Fall ist zwar bereits Haut- oder Gewebe abgestorben, doch die tatsächliche Tiefe der Wunde bleibt unklar, solange das abgestorbene Gewebe nicht entfernt wurde.
Typische Risikofaktoren für einen Dekubitus
Ein Dekubitus entsteht selten durch eine einzige Ursache – meist kommen mehrere Risikofaktoren zusammen, die sich gegenseitig verstärken. Neben anhaltendem Druck spielen auch Scherkräfte eine wichtige Rolle. Sie entstehen, wenn sich Haut- und Gewebeschichten gegeneinander verschieben – etwa beim Hochziehen im Bett oder beim Abrutschen in der Sitzposition. Dadurch wird die Durchblutung zusätzlich beeinträchtigt, und das Risiko für Hautschäden steigt deutlich.
Zu den häufigsten Risikofaktoren zählen:
Dekubitus-Behandlung – so wird die Wunde versorgt
Dekubitus-Prophylaxe – so beugen Sie vor
Bewegung und Lagerung
Hautpflege und Beobachtung
Hilfsmittel, die unterstützen
Ernährung, Flüssigkeit und Durchblutung
Schulung, Dokumentation und Früherkennung
Fazit: Früh erkennen, gezielt handeln, liebevoll pflegen
Dekubitus: Häufig gestellte Fragen
Welche Körperstellen sind am meisten gefährdet?
Vor allem Gesäß, Steißbein, Fersen, Schultern und Ohren. Bei sitzenden Personen auch der Rücken oder die Sitzbeinhöcker.
Wann sollte ärztliche Hilfe geholt werden?
Bereits bei anhaltender Rötung oder Hautverletzung sollte ein Arzt informiert werden – je früher, desto besser.
Welche Symptome zeigt ein beginnender Dekubitus?
Im Pflegealltag spricht man meist von Anzeichen statt von Symptomen – gemeint sind die ersten sicht- oder spürbaren Veränderungen der Haut. Typisch ist eine Rötung, die auch nach Entlastung nicht verschwindet. Die Haut kann sich warm, verhärtet, geschwollen oder empfindlich anfühlen; manchmal berichten Betroffene auch über Brennen oder Schmerzen. Im weiteren Verlauf können Blasen, nässende Stellen oder dunkle Verfärbungen entstehen – ein Hinweis darauf, dass bereits tiefere Gewebeschichten geschädigt sind.
Ist ein Dekubitus am Po häufig?
Ja, sehr. Das Gesäß und besonders das Steißbein gehören zu den am häufigsten betroffenen Stellen. Hier lastet beim Sitzen oder Liegen ein großer Teil des Körpergewichts auf relativ wenig Weichteilgewebe. Zusätzlich können Feuchtigkeit durch Schwitzen oder Inkontinenz und zu wenig Bewegung das Risiko erhöhen.
Wie lautet die Mehrzahl von Dekubitus?
Die korrekte Mehrzahl lautet Dekubiti – auch wenn der Begriff „Dekubitusstellen“ im Pflegealltag oft gebräuchlicher ist.

Zur Autorin
Isabell Jungesblut
Als Expertin für Gesundheits- und Krankenpflege bringt Isabell Jungesblut umfangreiche Erfahrungen aus der Akutversorgung aber auch aus der vollstationären Langzeitversorgung mit. Hier im Pflege ABC teilt sie ihr umfangreiches Wissen mit Ihnen, um die Pflege für Sie zu erleichtern.
Neue Artikel in unserem Magazin
Zum Newsletter anmelden
Erhalten Sie regelmäßig kostenlose Updates.
Vielen Dank.
Wir haben Ihnen eine Mail geschickt. Bitte bestätigen Sie den enthaltenen Link.
Wir haben Ihnen eine Mail geschickt. Bitte bestätigen Sie den enthaltenen Link.